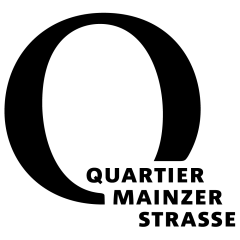Das Programm für die Hoffeste steht fast fest und bald erscheint unser Festplakat.
Quartier Mainzerstrasse
Der Chef ohne Krawatte – Klaus Erfort
Der Chef ohne Krawatte
Der Saarbrücker Drei-Sterne-Koch Klaus Erfort sucht nach einer neuen Überholspur
Von Cathrin Elss-Seringhaus, Saarbrücker Zeitung 4. April 2016
Klarheit ist für den Star-Koch Klaus Erfort (44) nicht nur auf dem Teller ein Credo. Auch als Mensch steht er für Geradlinigkeit. Seit acht Jahren zählt er zur Welt-Elite der Köche und wünscht sich, er hätte sich mehr Zeit genommen, den Aufstieg zu genießen.
Saarbrücken. Angeblich muss man seinen Master in Chefdiplomatie gemacht haben, um als selbstständiger Küchenchef in der Luxusklasse zu überleben. Doch Klaus Erfort eilt genau der gegenteilige Ruf voraus. Er selbst sagt: „Ich kenne mein Image. Nicht jeder kommt zurecht mit meiner direkten Art.“ Und Erfort nicht mit Gästen, die nicht rausrücken mit Kritik und dann das Team „hintenrum“ schlechtreden. Also bitte, lieber Gast, immer raus mit der Meinung und keine Etikette-Pirouetten drehen in der Mainzer Straße 95. Denn der Chef trägt im Sommer schon mal türkisfarbene Shorts unter der Schürze.
Erfort, der vor fünf Jahren seinen Servicechef Jérome dazu drängte, die Krawatte abzulegen, sagt: „Ein guter Bordeaux schmeckt auch aus dem Wasserglas.“ Zum deutschen Weingläser-Kult hält er eine gesunde Distanz, wie auch zur avantgardistischen Konzeptküche. Kompakt und puristisch geht es auf Erforts Tellern zu: „Alle sind froh, wenn sie etwas wiedererkennen. Mit 34 Grüßen aus der Küche überfordert man die Leute.“ Vor drei Jahren drehte Erfort das sehr kühle Ambiente seines Gästehauses in Richtung Behaglichkeit: „Wenn der Gast irgendwann entspannt die Schultern runterlässt, haben wir gewonnen“, sagt er. Und: „Am besten läuft’s bei uns in der Küche, wenn wir die Gäste lachen hören.“
Er müsse dann gar nicht mehr raus an die Tische und „stören“, so sieht er das. Erfort weiß sowieso haargenau, wer an welchem Tisch sitzt und wie fest oder weich der ein oder die andere das Risottokorn mag. Das Studium der Gästeliste ist für Erfort Tagespflicht, fremde Namen werden auch schon mal gegoogelt.
Mancher Kunde folgt Erfort seit dessen ersten Küchenchef-Tagen im Völklinger Parkhotel Gengenbach, das war 1995, nach diversen Sterne-Top-Stationen von der „Villa Fayence“ (Wallerfangen) bis zum „Restaurant Bareiss“ und der „Traube Tonbach“ (beide Baiersbronn). 2002 machte sich Erfort selbstständig. Heute hat er 50 Prozent Stammkunden: „Vom Sternetourismus können wir hier im Saarland nicht leben“, sagt er und ist sichtlich stolz darauf, dass sein Laden Geld verdient, während in anderen Sternerestaurants, etwa auf Sylt, die Rollläden runtergehen. Gerade hat Erfort die Mietoption für weitere fünf Jahre gezogen. Im Hof der stilvollen Villa mit Garten steht der weiße Porsche. Ein Statussymbol für einen, der aus einem kleinen Beamtenhaushalt in Fischbach stammt? Jawohl, als Koch-Lehrling träumte Erfort von dieser Art Belohnung für den harten Job, wie ihn sich sein Chef Rudi Kubig aus der Saarbrücker „Winzerstube“ gegönnt hatte. Heute schätzt Erfort die Marke „als Symbol gegen die Schnelllebigkeit“ – gibt freilich selbst gerne Gas. Auch in der Küche gilt: „Ich kann bei mir in kürzester Zeit Höchstleistungen abrufen.“ Trotzdem musste sich auch ein Erfort breiter aufstellen, ist Mitinhaber der Saarbrücker Schlachthof-Brasserie (Bib Gourmand), betreibt das Hotel Fuchs am St. Johanner Markt, ist für den Wirtschaftsball eine Kooperation mit Party Christ eingegangen. Außerdem erfand er 2015 das „Foodquartier“ in der alten Buswerkstatt am Eurobahnhof: Die preisgünstige Sterneküche war nur 76 Tage lang zu haben. Erfort hält es für symptomatisch, dass dieses erste Pop-up-Restaurant nicht mehr Furore machte: „Man traut sich im Saarland nicht, etwas hier Entwickeltes richtig gut zu finden. Das Saarland ist wie ein Tümpel. Es fließt Wasser ab, aber nur wenig frisches zu.“
Sind solche Innovationen die Überholspur, auf der Erfort so gerne unterwegs ist? Was tun, wenn mit Anfang 40 und drei Sternen der Berufs-Zenit bereits erreicht scheint? Vor zwei Jahren verschob Erfort die Gewichte im Leben. Der Sport ist hinzugekommen, samt kohlenhydratreduzierter Kost und dem persönlichen Trainer Daniel (27). Er versucht, spontaner zu leben, mal eine Spritztour nach Südtirol zum Männerski einzuschieben. Gerne isst er bei seinem Freund Franco in der Trattoria „Mille Aromi“: „Eine Seezunge und eine Schüssel Salat, was will man mehr?“
Erfort lebt in Spicheren, getrennt von seiner Lebensgefährtin, mit der er einen Sohn (13) hat. Nicht seinen Beruf, sein Lebens- und Karrieretempo empfindet er als strapaziös. Er habe keine Zeit gehabt, den Aufstieg zu genießen, meint er. Wenn er rückwärts leben könnte, dann würde er genau dies tun: langsamer genauso erfolgreich sein.
Sport und Genuss schließen sich nicht aus: Der Saarbrücker Drei-Sterne-Koch Klaus Erfort beim Training mit seinem Personal-Trainer Daniel Rauland an der Berliner Promenade. Foto: Rich Serra
Nauwieser Fest auf der Kippe
Nauwieser Fest auf der Kippe
Veranstalter am Ende der Reserven – Suche nach Sponsoren gestaltet sich schwierig
Von Martin Rolshausen, Saarbrücker Zeitung 30. März 2016
Steigende Kosten, vor allem für Sicherheitsauflagen, zwingen die Viertelfest-Organisatoren von Rockstar e.V. in die Knie. Der Verein sucht händeringend neue Sponsoren, auch kleine Summen können schon helfen.
St. Johann. 14-mal ist alles gut gelaufen. Bei den Vorbereitungen zum 15. Nauwieser Fest haben die Männer vom Rockstar e.V. gemerkt: Es wird eng. Andreas Borger, einer derer, die das Fest organisieren, spricht von einer „Unterdeckung von rund 10 000 Euro“. Es sei „alles teurer geworden“, und auch für Sicherheitsauflagen müsse „der Verein zur Förderung der schönen Künste“ mehr Geld ausgeben als bisher. Darüber wolle er auch gar nicht jammern, sagt Borger. Das Problem sei nur: Der gemeinnützige Verein habe keine Reserven – und wenn sich nicht mehr Sponsoren als bisher finden, dann sei das Fest ernsthaft in Gefahr.
Einige der langjährigen Sponsoren, etwa die Brauereien, haben ihr Engagement fürs Nauwieser Fest eh schon verstärkt, sagt Borger. Auch bei den Standmieten sei nichts mehr zu machen. Neue Sponsoren zu finden, habe sich bisher als schwierig erwiesen. „Das Nauwieser Fest ist keine Leuchtturmveranstaltung wie das Saar-Spektakel oder das Altstadtfest“, erklärt er.
Nachdem klar war, dass der Verein das finanzielle Risiko nicht tragen kann, habe man mit der Stadtverwaltung gesprochen. Die habe darum gebeten, dass der Verein das Fest weiter organisiert. Eine Vereinbarung gab es nicht. Und die Vereinsleute haben es auch nicht übers Herz gebracht bei ihrem „Wir schaffen das finanziell nicht. Wir hören auf“ zu bleiben. Wenn die Stadt das Fest selbst übernehmen würde, würde es wohl teuerer als bisher, vermutet der Verein. Viele der Helfer arbeiten zum „Freundschaftspreis“. Der Verein hat auch einen „großen Helferstamm, auf den wir uns verlassen können“, sagt Borger.
Also wurde neu nachgedacht. Das Ergebnis: 50 000 zusätzliche Euro hat der Verein inzwischen so gut wie sicher. Love A, Steakknife, Pascow und Illegale Farben – vier Bands, die seit Jahren immer wieder auf dem Fest spielen – nehmen eine Platte auf. Eine echte Schallplatte aus Vinyl. Die Bands, sagt Andreas Borger, seien bundesweit bekannt, und eine Vinylplatte habe einen höheren Sammlerwert als eine CD – bringe also mehr Geld fürs Fest. „Das mit der Platte hatten wir in zwei Tagen klar“, sagt er.
Es fehlen also noch 5000 Euro. Es müsse ja kein neuer Großsponsor sein, sagt Borger. Denn: „Wenn zehn Leute oder Firmen jeweils 500 Euro geben, wäre das Fest auch gesichert“. Dann würde auch beim 15. Fest alles gut laufen.
Kontakt: E-Mail an info@rockstar-ev.com
Jährlich zieht das Viertelfest tausende Besucher an, ob es in diesem Jahr stattfinden wird, ist noch in der Schwebe.
Archiv-Foto: Iris Maurer
Kohl ist bester „fachgeprüfter Bestatter“
Kohl ist bester „fachgeprüfter Bestatter“
Bei der Weiterbildung der Handwerkskammer war er spitze
Von Frank Bredel, Saarbrücker Zeitung 03. März 2016
Nach dem Tod eines Angehörigen ist es für die Hinterbliebenen wichtig, sich würdevoll verabschieden zu können. Diesen Wunsch will Bestatter Stefan Kohl erfüllen und bald seinen Kunden „Abschiedsräume“ bieten.
Saarbrücken. Wenn ein Bestatter mit 13-jähriger Berufspraxis plötzlich nochmal die Schulbank drückt, um etwas dazuzulernen, nennt man das „Weiterbildung“. Die Handwerkskammer zeichnete den Bestatter Stefan Kohl (39) aus Sarbrücken als Weiterbildungsbesten im Lehrgang „Fachgeprüfter Bestatter“ aus.
Das Besondere hier: Die Auszubildenden sind Profis, verdienen längst ihre Brötchen im Job. Stefan Kohl ist Chef des Bestattungshauses Pietät von Rüden. Warum der gelernte Betriebswirt trotzdem nochmal mehrere Monate den Kurs besuchte? „Weil ich neue Kollegen kennenlernen und mein Wissen vertiefen wollte. Die Abschlussprüfung brachte mir ein Zertifikat, viele Kunden achten auf sowas“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Und er legt gleich noch einen Kurs obendrauf. Kohl meldeten sich gleich zum Meisterkurs an, der im nächsten Jahr endet. „Wir waren 14 Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Alles Kollegen, die schon im Job stehen und von denen man etwas lernen kann“, lobte Kohl die Weiterbildung. Der 39-Jährige war Teamleiter bei Globus, hatte aber schon als Jugendlicher ein Faible für Bestattungen: „Mich zog die reine Neugierde in den Job.“ Als Messdiener habe er Beisetzungen begleitet, später Geld als Einsargungshelfer dazuverdient, dann den Job gewechselt. Und in dem ist er recht offensiv unterwegs, betreibt eine Facebookseite, erhielt eine Auszeichnung beim Staatspreis für Design mit seiner Webseite und plant in St. Arnual einen neuen Firmensitz in einem ehemaligen Supermarkt. Auf 12 000 Quadratmetern in der Saargemünder Straße errichtet Kohl dort einen Zweitsitz mit Kühlräumen für Leichen, mit Arbeitsräumen für die Bestatter und mit Abschiedsräumen für Angehörige, wie es sie in Saarbrücken noch nicht gebe. Abschiedsräume auf Friedhöfen seien nur eingeschränkt zugänglich, der oder die Tote stets hinter Glas. Das wirke immer kalt und steril. Das werde in St. Arnual anders. Hier werde der Leichnam offen aufgebahrt, Angehörige könnten zu jeder Zeit in den Raum. „Wir haben mit der Oberbürgermeisterin gesprochen. Sie kann neue Abschiedsräume an den Friedhöfen aus Finanzmangel nicht realisieren und hat uns für das private Vorhaben grünes Licht gegeben“, sagt Kohl, dem es wichtig gewesen sei, dass die Friedhofsverwaltung einverstanden ist und dem Kunden keine Extrakosten entstehen. Sein Job macht ihm Freude: „Ja, es macht sogar Spaß, denn die Kunden sind sehr dankbar, weil man ihnen hilft“, erzählt Kohl.
Stefan Kohl leitet das Unternehmen Pietät von Rüden und will eine Filiale in St. Arnual eröffnen. Foto: Becker&Bredel
Nachwuchs für das Nachwuchs-Kino – Das Ophüls-Festival hat eine neue Leiterin
Nachwuchs für das Nachwuchs-Kino
Das Ophüls-Festival hat eine neue Leiterin
Von Tobias Kessler, Pfälzischer Merkur vom 27.02.2016
Svenja Böttger heißt die neue Leiterin des Saarbrücker Filmfestivals Max Ophüls Preis. Das hat der Aufsichtsrat des Festivals am Freitag einstimmig beschlossen. Die Berlinerin ist 27 Jahre alt, studiert noch, hat aber bereits Festival-Erfahrung. Ihr Vertrag läuft drei Jahre.
Saarbrücken. Als 1980 das erste Ophüls-Festival über die Bühne ging, war seine neueste Leiterin noch nicht geboren. Die Nachwuchs-Filmschau bekommt nun ihre bisher jüngste Leiterin: 27 Jahre alt ist Svenja Böttger, die in den nächsten drei Jahren das Filmfestival Max Ophüls Preis leiten soll. Der Aufsichtsrat und die Stadt Saarbrücken teilten die Neubesetzung am Freitag mit. Da war die Medienwissenschaftlerin nach ihrem Bewerbungsgespräch schon wieder in Berlin; vorstellen will sie ihre Pläne erst, wenn sie mit dem Festivalteam gesprochen hat. Aber sie teilte schon mal mit, die Festivalleitung sei „eine Ehre“.
Böttger schließt laut Stadt gerade ihr Masterstudium an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf ab, zuvor studierte sie in Braunschweig Medien- und Kunstwissenschaft. 2014/2015 war sie für die Gesamtleitung des Empfangs der Filmhochschulen während der Berlinale verantwortlich; 2014 leitete sie das internationale Studentenfestival ihrer Hochschule, „Sehsüchte“. Dort habe sie bereits Festivalteams geleitet und „gute Kontakte zu den Filmhochschulen im deutschsprachigen Raum“ aufgebaut, attestiert ihr die Stadt. Ein Artikel der „taz“ von 2014 über Filmstudenten nennt Böttger im Zusammenhang mit „Sehsüchte“ gar „so etwas wie die studentische Version von Berlinale-Chef Dieter Kosslick“.
Fünf Bewerber hatten sich am Donnerstag in Saarbrücken einer Auswahlkommission vorgestellt, der neben je einem Stadtratsmitglied von SPD, CDU, Grüne und Linke auch Dieter Wiedemann angehörte, bis 2012 Präsident der Filmuni Babelsberg Konrad Wolf, und Gabriele Brunnenmeyer, zuständig für „Projektbetreuung Talentfilm“ beim Kuratorium junger deutscher Film. Sie empfahlen Böttger dem neunköpfigen Ophüls-Aufsichtsrat, der sich einstimmig für sie entschied. Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Latz (SPD) versprach Böttger „eine breite Unterstützung“. Das klingt ermutigend, war dies doch genau das, was der Festivalleiterin Gabriella Bandel zuletzt nicht mehr zuteil wurde – sonst hätte man sie beim Festival behalten.
Dass die jetzige Kandidatensuche ohne öffentliche Ausschreibung ablief, hatte vorab zu Diskussionen geführt: Für die Stadt ist das „im Kulturbereich nicht unüblich“, für die Opposition allerdings „ein Hau-Ruck-Verfahren“ und „Täuschung“ (CDU) sowie ein „fatales Agieren“ (FDP). Als die Stadt ihrerseits darauf verwies, man habe sich auch von Vertretern des Verbands deutscher Filmkritiker (VDFK) beraten lassen, widersprach der prompt: Es habe „keinerlei Beratung“ gegeben, „im Gegenteil beobachtet der VDFK mit Sorge und Verwunderung, wie ein funktionierendes, über Deutschland hinaus renommiertes Festival durch politische Willkür gefährdet wird“.
Böttger muss jetzt Ruhe ins Festival bringen. Denn der unwürdige Abschied der erfolgreichen Leiterin Gabriella Bandel hat die Ophüls-Reputation beschädigt: mit der Sprachregelung einer „einvernehmlichen Entscheidung“, gefolgt von verdächtig lautem Schweigen der Beteiligten – und dann doch noch Aussagen vom Aufsichtsrat, denen Bandel energisch widersprach. Ophüls – ein Scherbenhaufen.
Dieser Hintergrund könnte erklären, dass sich mit fünf Kandidaten recht wenig Bewerber gemeldet haben – als die Stadt 2005 einen Nachfolger für den scheidenden Ophüls-Leiter Boris Penth suchte, meldeten sich immerhin 15. Zurzeit wird etwa kolportiert, ein Großteil des Festivalteams sei frustriert abgewandert, zum Teil in Richtung Hof; Festival-Sprecherin Karin Kleibel erklärte am Freitag auf Anfrage, dass nur zwei Personen aus dem Team das Festival verlassen und das schon länger geplant hätten. Gerüchte, Spekulationen – beim Festival ist noch keine Ruhe eingekehrt.
Meinung:
Alle Händevoll zu tun
Von Merkur-MitarbeiterTobias Kessler
Jede Menge zu tun gibt es für Svenja Böttger. Sie muss mit einem stagnierenden Festival-Etat arbeiten, also sparen, ohne dass es auffällt. Sie muss aus dem Scherbenhaufen, den der Streit um dem unwürdigen Abschied der sehr erfolgreichen Festivalleiterin Gabriella Bandel hinterließ, wieder eine grüne Wiese machen, auf der sich ebenso junge Filmemacher wie bewährte und vielleicht auch neue Sponsoren gerne niederlassen. Ach ja, ein gutes Filmprogramm muss sie sowieso präsentieren. Ihr Vorteil: Trotz personeller Turbulenzen steht das Festival künstlerisch exzellent da. Willkommen bei Ophüls – und toi, toi, toi.
Svenja Böttger, die neue Ophüls-Leiterin. Foto: Böttger
Platz für grüne Architektur – 26 Bäume und 80 Parkplätze müssen neuem Campus der Musikhochschule weichen
Platz für grüne Architektur
26 Bäume und 80 Parkplätze müssen neuem Campus der Musikhochschule weichen
Von Sarah Umla, Saarbrücker Zeitung 26. Februar 2016
Die Bauarbeiten an der Musikhochschule sollen am 1. April starten – mit ihnen fallen auch die 80 Parkplätze dauerhaft weg. Seit gestern werden schon 26 Bäume für die Neugestaltung des Campus gefällt.
Saarbrücken. Es wird geschreddert und gesägt in der Bismarckstraße. Einige Bäume zwischen der Musikhochschule und dem Museum müssen weichen. Sie sollen Platz für einen grünen und parkähnlichen Campus machen zwischen der Hochschule und dem Museum. Das sieht das Konzept des Berliner Architekturbüros Kuehn Malvezzi und des Künstlers Michael Riedel vor. Die großen Stämme werden auf Transporter verladen, Geäst und Baumkronen direkt zu Sägespänen weiterverarbeitet. Vereinzelt können Bäume in der Bismarckstraße nach Angaben der Pressesprecherin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Myriam Best-Wollbold, in das neue Architekturkonzept eingebunden werden.
Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann auch zwölf neue Bäume gepflanzt werden. Immer mit dem Ziel: mehr Aufenthalts- und Erlebnisqualität in der Innenstadt zu bieten. Die Bauarbeiten sollen nach Angaben des Musikhochschul-Rektors Wolfgang Mayer zwölf Monate dauern.
Doch auch die rund 80 Parkplätze vor der Hochschule für Musik (HfM) Saar verschwinden ab dem 1. April dauerhaft. Stellflächen für Autos soll es vor Ort künftig nicht mehr geben. Für die unter anderem 80 Lehrbeauftragten, 450 Studenten und die Konzertbesucher bedeutet das eine Umstellung, denn manche von ihnen reisen mit dem Auto an. Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es in der Umgebung kaum. Natürlich könne auf Parkhäuser in der Innenstadt ausgewichen werden, so etwa am Rathaus oder in der Talstraße am Schloss, sagt Alfred Jost. Konzertbesucher haben die Möglichkeit, mit dem Theaterticket des Staatstheaters von 18 bis 24 Uhr zu parken, welches pauschal 5,50 Euro kostet. Für Lehrbeauftragte und Studenten hat die Hochschule vorerst zwei Lösungen gefunden: Zum einen das neue HTW-Parkhaus an der Malstatter Brücke. Zum anderen für drei Monate den großen Hof der früheren Citroën-Niederlassung in der Großherzog-Friedrich-Straße. „Wir bemühen uns, dauerhafte Lösungen zu finden“, verspricht HfM-Rektor Wolfgang Mayer. Seit dem Sommersemester suche die Musikhochschule schon nach Alternativen. „Wir haben direkt angefangen, als wir über die Auswirkungen Bescheid wussten“, erläutert Jost.
Der Umbau bedeute trotz Verlusts der Parkplätze aber eine deutliche Verbesserung für die Hochschule. „Wir identifizieren uns nicht durch die Parkplätze, sondern durch die Qualität unserer Lehre“, sagt Jost. Mit dem neuen Campus stehe die Hochschule auch äußerlich gut da. „Das Umfeld neuzugestalten ist ein gutes Signal für unsere Hochschule“, sagt Mayer.
Aktuell führt die Hochschul-Spitze Gespräche mit dem saarländischen Verkehrsverbund sowie dem Wirtschafts- und Bildungsministerium, um den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Vor allem die Verbindung von der Musikhochschule an die Saar-Uni sei ausbaufähig. Rektor Mayer sagt, er hoffe, dass künftig mehr Busse das Staatstheater und die Haltestelle St. Johanner Markt anfahren können.
Ob die Hochschule durch den Verlust der Parkplätze an Attraktivität verliere, hält Dozenten-Sprecherin Jutta Ernst für „reinste Spekulationen“. Denn die Dozenten an der Musikhochschule sind freiberuflich. „Das ist ja nicht das Haupteinkommen der Lehrbeauftragten“, erklärt Ernst.
Auch Jost betont: „Wer an der Hochschule für Musik lehrt, ist zwischen einer und achteinhalb Stunden in der Woche zum Lehren vor Ort.“ Asta-Vorsitzender Jakob Scherzinger kritisiert dagegen den Wegfall der Parkplätze. „Wir sind in unserer Mobilität total eingeschränkt“, sagt er.
Park-Stress und Ausnahmezustand rund um die Musikhochschule
Park-Stress und Ausnahmezustand rund um die Musikhochschule
Saarbrücker Zeitung vom 25. Februar 2016. Von SZ-Redakteurin Esther Brenner, ce
Studenten und Dozenten warnen vor einem Attraktivitätsverlust der Musikhochschule, wenn ab April 80 Parkplätze wegfallen. Rektor Wolfgang Mayer setzt auf verbesserte Nahverkehrsverbindungen.
Saarbrücken. Bequemlichkeit versus Schönheit? Dieses Konfliktfeld spannte sich bereits im September 2014 auf. Als die Architekturpläne für den Museums-Erweiterungsbau präsentiert wurden, war der Wegfall von Parkraum rund um die Hochschule für Musik Saar (HfM) mitbeschlossene Sache. Denn die Gelände der beiden Nachbar-Institutionen sollen zu einem parkähnlichen Campus-Areal verschmelzen – eine Aufwertung, das ist unstrittig.
Doch wer Campus sage, müsse auch für Parkplätze sorgen. So sehen das Lehrbeauftragte und Studenten der HfM und kritisieren ein von Autos leer gefegtes Umfeld. „Die Bedürfnisse der Musikhochschule sind bei den Planungen übergangen worden“, sagte der Asta-Vorsitzende Jakob Scherzinger gestern bei einem Pressetermin in der Hochschule. Dozenten-Sprecherin Jutta Ernst nannte den Verlust der 80 Parkplätze „eine mittlere Katastophe“. Man fürchte, dass Dozenten „das Handtuch werfen“, weil der Unterricht unlukrativ werde, wenn überteuerte Parkgebühren in der Theater-Tiefgarage oder Dauer-Stellplätze zu bezahlen seien. Auch für Konzertbesucher und Studenten wiege eine gute Erreichbarkeit schwerer als ein architektonisches Top-Umfeld, so Ernst.
Von „einschneidenden“, aber verkraftbaren Veränderungen sprach hingegen HfM-Rektor Wolfgang Mayer. Er nannte erste Problemlösungsansätze. Zum einen erhielten Studenten und Dozenten die Möglichkeit, das HTW-Hochhaus an der Autobahn zu nutzen (und dann mit dem Bus zur HfM zu kommen), auch könnten Konzertbesucher zwischen 18 und 24 Uhr das Theaterticket für 5,50 Euro in der SST-Tiefgarage nutzen. Zudem sei man auf der Suche nach einem Park&Ride Gelände und führe zusammen mit dem Wirtschafts- und Kultusministerium Gespräche mit dem Saarländischen Verkehrsverbund, um eine bessere Bustaktung und Nahverkehrsanbindung für die Musikhochschule zu schaffen. Langzeit-Projekte, doch der Parkplatz-Verlust wird schon ab 1. April zur unbequemen Tatsache. Von da an präsentiert sich die Musikhochschule, ähnlich wie die Moderne Galerie, als abgeriegelter Baustellenbezirk samt Absperrungen und einem neuen Zugang. Laut Rektor Mayer mindestens zwölf Monate lang.
„Ich kann mehr als nur kochen“ Zwei Sterne machen weder reich noch glücklich: Jens Jakob
„Ich kann mehr als nur kochen“
Zwei Sterne machen weder reich noch glücklich: Jens Jakob, Teil drei der SZ-Serie
Saarbrücker Zeitung vom 22. Februar 2016. Von SZ-Redakteurin Cathrin Elss-Seringhaus
Er ist der Businessmann unter den Sterneköchen: Jens Jakob hat Saarbrücker Szenelokale aufgebaut und sich im „Le Noir“ zwei Sterne erkocht. Der 43-Jährige hat mehrfach Saar-Küchengeschichte geschrieben.
Saarbrücken. Wer mit ihm spricht, weiß hinterher viel übers „Business“. Etwa, warum die Sterneküche seiner Meinung nach überall in der Krise stecke – weil schärfere Bestechlichkeitsregelungen Luxus-Geschäftsessen selbst für Unternehmens-Vorstände heikel machen. Und dass der Trend selbst in der Luxusküche „Casual“ heißt: Der Gast, so Jens Jakob (43), wolle sich weder einen Schlips umbinden noch vier Stunden bei Barockklängen Häppchen an sich vorbeiziehen lassen. Jakob sagt: „Ich kann mehr und noch andere Sachen als nur kochen. Ich wollte immer auch Geschäftsmann sein.“ Der gebürtige Saarbrücker fährt nun mal gern vielgleisig. Auch jetzt im Saarbrücker Hotel Domicil Leidinger legt er in seinem Sternerestaurant nicht nur Kaviarkügelchen-Muster, er betreibt dort die gesamte Gastronomie: Panetterie mit Bar und Lounge sowie das legere Restaurant „s’Olivio“.
Während des Max-Ophüls-Festivals tanzt dort der Bär durch alle Gänge. Hoher Geräuschpegel, Musik, Gelächter, verschiedene Nationalitäten, Generationen und Modestile: „Genau das ist Gastronomie“, sagt Jakob. Die Sterneküche sei nur eine Facette. Action und Abwechslung, die liebt der Sportfanatiker (Golfen, Surfen, Tennis). Achterbahn-Feeling inklusive. Daraus, dass er wirtschaftliche Probleme kennt, macht Jakob keinen Hehl.
Er spricht mit High-Speed und Temperament, redet nicht um den heißen Küchenbrei. Ein vitaler, aufgekratzter Typ, der sich als hyperaktives Kind schildert: „Ich war immer schon die Unruhe selbst.“ Beste Voraussetzungen für den Job als Koch, denn: „Zehn Dinge gleichzeitig im Auge behalten, das lernen Köche.“ Er selbst machte erst mit über 30 seine Meisterprüfung, da war er schon fest angestellt bei Klaus Erfort. Zum Kochen war er eher zufällig gekommen. Seine erste Freundin, erzählt Jakob, war die Tochter eines Vollblut-Gastronomen, des legendären „Hummerherbert“. Und auf die Gesamtschule Rastbachtal hatte Jakob keine Lust mehr. Nach Stationen in Topläden wie der Hostellerie Bacher oder dem Saarbrücker „Légère“ verabschiedete sich Jakob in die Kneipenszene. Jahrelang managte er die Cocktailbar im Saarbrücker Club „Number one“, baute am St. Johanner Markt Szene-Lokale wie das „Sankt J“ auf, wechselte später ins alternative Nauwieser Viertel (Mono, Karateklub Meier, Nauwies). Ein Enfant terrible in der Gourmetwelt?
Jakob hat gleich mehrfach Saar-Küchengeschichte geschrieben. 2013, als er sich mit seinem ziemlich winzigen, „Le Noir“ in der Saarbrücker Mainzer Straße den zweiten Michelin-Stern erkochte und damit im Ranking auf Platz drei direkt nach den Giganten Christian Bau und Klaus Erfort landete. Als Jakob die Sterne 2014 verlor, weil Sterne nicht an den Koch, sondern an den Ort gebunden sind und Jakob ins Saarbrücker Hotel Domicil Leidinger umziehen wollte, erregte dieser riskante Schritt Aufsehen. Noch mehr, als Jakob wenige Monate später seine Sterne wieder zurückhatte, um dann 2015 das „Le Noir Gourmet“ einfach zuzusperren. Jakob gab die Sterne zurück, machte Schluss mit der Luxusküche, um ein neues, das heutige Konzept für „Jens Jakob. Das Restaurant“ zu installieren. Und auch dafür gab’s wieder einen Stern. „Ich weiß nun mal, wo der Gaul lang läuft“, sagt Jakob. „Ich steuere das. Ich könnte sofort wieder den zweiten Stern erkochen.“ Doch das würde bedeuten, nochmal 30 Angestellte bezahlen zu müssen: „Das hat mich erdrückt. Ich musste neue Wege gehen.“
Und wie schafft man den Sprung in den kulinarischen Sternenhimmel? „Viel Butter, alles durch ein sehr feines Sieb jagen und mehr schäumen.“ Wenn’s so einfach wäre. Für Jakob haben die Hitlisten der Feinschmecker-Communities an Bedeutung verloren: „Wenn man sonst keine Probleme hat . . .“, kommentiert er. Seine Berufs- und Lebenseinstellung habe eine biografische Krise verändert. Im Herbst 2014 wurde Jakobs Mutter schwer krank, seine Partnerschaft war kaputt. Plötzlich war Jakob drei Mal die Woche alleinerziehender Vater. Er zog in eine Zweier-Männer-WG mit seinem Küchenchef Peter Wirbel, Sonntag und Montag gehören niemand anderem als Sohn Jan-Alexander (4) – Businessverbot. Zwischenzeitlich gibt es auch wieder eine Frau an seiner Seite. Er habe zu sich gefunden, meint Jakob.
Was für einen wie ihn nicht bedeutet, stehen zu bleiben. Er saust gedanklich um die Problemfelder seiner Branche: „Wo isst der Gast, der nicht mehr so häufig kommt?“, fragt Jakob. „Zu Hause!“ Man sieht, wie es hinter seiner Stirn arbeitet.
Die SZ stellt jeden Montag vom Guide Michelin ausgezeichnete Köche der Region vor.